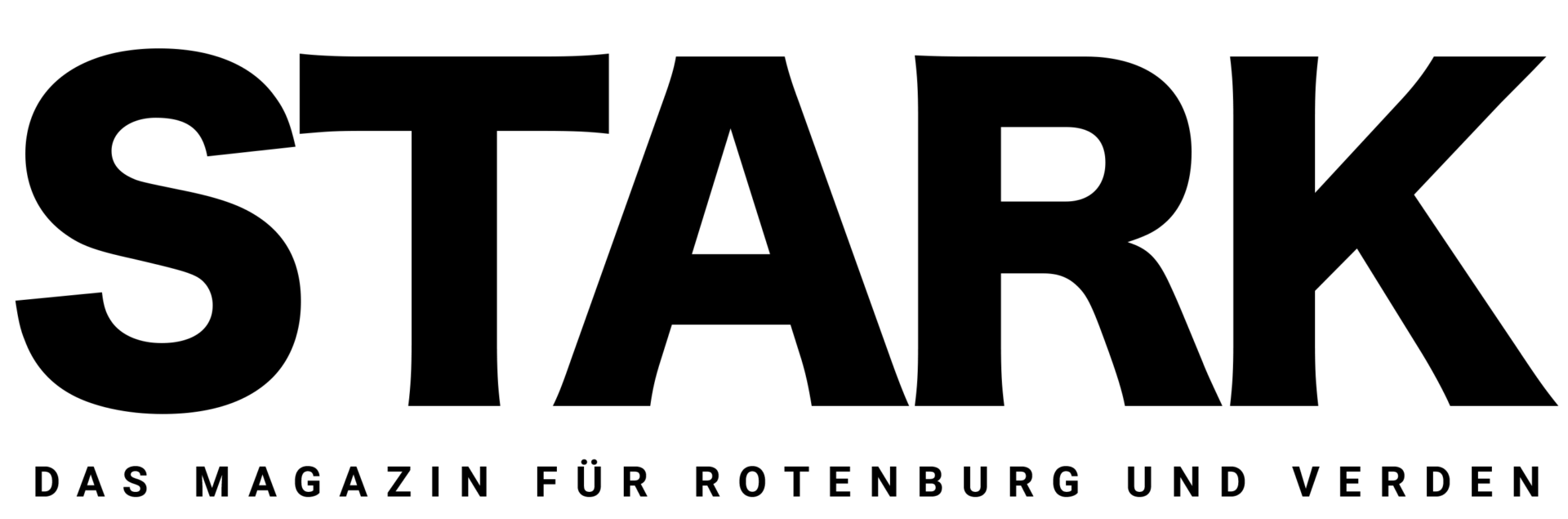Schritt 1: Stelle – dich deiner Angst
Ich hörte nicht auf meine Eltern. Und als ich nach der Erstbesichtigung einen Termin bei der Bank machte, ohne die ernsthafte Hoffnung auf einen Kredit, führte mich die Bankberaterin in einen Glaswürfel, der ein Büro darstellte, drückte sich das Klemmbrett auf die Brust und sagte, es ginge ja weniger darum, einen Kredit zu bekommen, man könne ja über alles reden. Sie interessiere vielmehr die Frage, ob ich mir ein solches Projekt zutrauen würde. Dieses Mal würde ich die Geister aufhalten, dachte ich. Ich würde nicht eskalieren, nicht rumschreien. Ich würde rein auf der Sachebene antworten. Als ich sinngemäß sagte, das werde wohl nicht so schwer, immerhin könne man kaum mehr kaputt machen als ohnehin schon kaputt sei, warf sie schallend-lachend ihren Kopf zurück – und in meiner Erinnerung schlägt sie sich dabei auf die Schenkel, was sie vermutlich nicht wirklich tat.
Es wurde immer schwerer, das auszuhalten, aber ich biss mir auf die Lippe. Natürlich hatte mich das Lachen meiner Bankberaterin ins Mark getroffen. Natürlich traute ich es mir nicht zu. Wenn man etwas oft genug hört, wird es schließlich Teil der eigenen Identität und damit vollkommen real, und letztlich versucht man es irgendwann auch nicht mehr. Aber wer würde das zugeben im Gespräch mit seiner Bank, frei nach dem Motto: „Stimmt, jetzt, wo Sie‘s sagen!“ Also unterschrieb ich.
Schritt 2: die Idee
Dieses Mal würde ich es nicht auf mir sitzen lassen und diesen Teufelskreis ein für alle Mal durchbrechen. Natürlich war ich nicht so dumm, gleich einen ganzen Bauernhof zu renovieren. Ich bin ja nicht Fynn Kliemann. Das kleine Backsteingebäude im Garten musste für meine Zwecke reichen. Es war das Testobjekt, bevor es an das Wohnhaus gehen sollte und es stand alleine auf einer Obstwiese in Niedersachsen. Ein Schreibhaus sollte es werden, für mich, den Schreiber. Ich stieß kräftig die Tür auf, was tatkräftig aussah, aber eigentlich meiner Spinnenphobie geschuldet war. Die Fenster waren überwachsen und blind. An der Decke feuchte Flecken. Es war düster und kalt. Der Dielenboden war zerkratzt und mit Farbflecken übersät. An einem Kabel hing eine Bauleuchte lichtlos von der Decke. Dies, dachte ich, würde mein DIY-Moment werden. Ich würde es mir und allen beweisen. Wenn ich es geschafft hätte, würde die Landlust zu Besuch kommen, wir würden lachen und selbst gebackenen Apfelkuchen essen, und ich würde sagen, dass ich immer ein Faible hatte für das Handwerk und als kleiner Junge schon alles zusammenbauen musste. Eine gleißende Zukunft stand mir bevor. Dann schloss ich die Tür, und etwas fiel mir in den Nacken.
Schritt 3: die Basics
Ich fuhr Richtung Baumarkt, drückte eine Münze in den Einkaufswagen und entriss ihn den anderen. Von den vielen praktischen und theoretischen Problemen, die ich zweifellos hatte, war das vielleicht drängendste, dass ich kein eigenes Werkzeug besaß. Abgesehen von einer Schachtel loser Ikea-Schrauben und einer Heugabel, in die ich zufällig beim Ausmisten auf dem Dachboden gestoßen war. Werkzeug leihen oder anderweitig um Hilfe bitten, das kam nicht infrage. Leute leihen einem nur Werkzeuge, indem sie kommen und sagen, dass man bitte, bitte unbedingt aufpassen müsse – und dann packen sie alles aus und erklären einem stundenlang irgendwelche Einzelteile. Dafür war keine Zeit. Ich schob durch die Abteilungen – Lampen, Kabel, Tiere, Pflanzen, Duschvorhänge für 3.99 – bis ich einen Tresen erreichte mit der Aufschrift „Beratung“. Dort orderte ich ein Werkzeug, wobei ich sagte, es solle nicht zu schwer sein, nicht zu teuer und mindestens haltbar. Ob es auch fliegen können sollte, fragte der Mann. Ich antwortete: Das sei kein Muss. In diesem Moment wurde mir, glaube ich, klar, dass mir dieses Projekt mehr abverlangen würde als gedacht, und dass es nicht reichen würde, ein bisschen Arbeit zu investieren. Anschließend wurde ich vor eine Wand gestellt, an der viele Werkzeuge hingen, die ich andächtig betrachtete. Nach einigem Zögern entschied ich mich für einen Akkubohrschrauber und einen Exzenterschleifer. Sicherheitshalber entschied ich mich für den teureren Schleifer mit einem bürstenlosen Motor, was mir besser erschien als einer mit Bürsten, weil, ansonsten würde man das sicher nicht draufschreiben. Da musste ich einfach vertrauen. Ich lud die Werkzeuge mit den praktischen Verkaufs-koffern in den Einkaufswagen und schob zurück an den Tresen, wo ich den Mann zutraulich fragte, weil ich dachte, damit erreicht man alles, ob er mir vielleicht erklären könne, wie man Trockenbau selber machte. Also das Einziehen von Wänden, die nicht tragend sind. Er schaute mich kurz an, dann die anderen Männer, die herumstanden und warteten. Schließlich sagte er: „Selbst? Besser gar nicht!“ Und dann lachten sie alle, so ehehehe, und grinsten frech. Mit Zutraulichkeit und Sensibilität musste ich nichts mehr versuchen. Das hatte schon als Jugendlicher darin geendet, dass ich nie eine Freundin gehabt hatte oder wenigstens Aussicht auf Pornohefte, weil man für beides das Risiko eingehen musste, abgewiesen zu werden. Und das war mir einfach zu viel Risiko. Ich sagte nichts mehr und fuhr heim. Zu Hause konsultierte ich das Internet.
Schritt 4: das Internet
Das Internet erwies sich als verlässlicher Partner und schlug mir eine Reihe von Youtube-Channels vor, in denen ältere Männer anderen, oft jüngeren Männern, langatmig und äußerst kenntnisreich vermittelten, wie man Dinge zu tun hatte; vor allem aber, wie man Dinge nicht zu tun hatte. Einer – meist ist es der jüngere – meint in solchen Videos immer abschließend, dass er das nicht gedacht hätte; dass das so einfach/so schwer sei mit dem Selbermachen. Die folgende Woche verbrachte ich vor dem Bildschirm mit dem Nachahmen von Bewegungen. Ich schaute Tutorials über Trockenbau, Videos über Akku-Bohrschrauber, Flex, Kreissäge, Winkelschleifer, Hochentaster, das Ausbauen von Schlössern unter Zuhilfenahme der Schlagbohrmaschine, die richtige Kleidung, die nicht richtige Kleidung sowie das Überbacken von allerlei Dingen mit Käse. Ich stellte eine Leiter ans Haus und begann mit dem Freischneiden. Der Blauregen, eine Kletterpflanze, hatte sich durch die Schindeln ins Dach gefressen (auf dem Dachboden entdeckte ich zwei opulente Wespennester aus alten Zeiten, eine Garnitur aus Tischen und Stühlen sowie einen alten Boiler), und es war verdammt schwer, ihn da wieder rauszukriegen. Kurz überlegte ich, auf das Dach zu steigen, aber Dächer waren hoch und überwachsene Schindeln unbarmherzig. Meine anfängliche Scheu würde ich ablegen müssen. Denn anders, als ich meiner Bankberaterin gesagt hatte, hatte ich durchaus Angst, etwas kaputtzumachen. Weshalb ich oft Dinge lange ansah und nachdachte, ohne sie tatsächlich anzufassen. Denn leider ist Handwerken mehr als Schleifen und Hämmern. Das Problem waren die Entscheidungen, die man zu treffen hatte. Die fielen mir besonders schwer. Das kleine Haus hatte einen Dielenboden, der ziemlich kaputt war. Dielen ließen sich gut schleifen, das hatte ich im Internet gelernt, aber nur, wenn noch genügend Holz auf den Brettern war. Meine zukünftigen Dielen waren knapp so breit wie mein kleiner Finger, was taugen musste, aber sie waren aus Kiefernholz, was ein weiches Holz ist, und worauf man jeden Abdruck sehen würde. Ich konnte also, wenn der Boden einmal geschliffen war, nicht mehr mit Schuhen darüber laufen – zumindest so lange nicht, bis der Boden lasiert war. Gleichzeitig musste ich auch streichen und stand vor einer Entscheidung. Das Bodenschleifen staubte enorm, was gestrichene Wände sofort rostbraun färben würde. Schliff man aber den Boden zuerst, ruinierte man ihn ziemlich sicher bei den Malerarbeiten. Ich stand da und wusste nicht, wie anfangen. Mir fehlten: räumliches Verständnis und Erfahrung.
In der Nähe wohnten zwei Handwerker, die ich unter dem Vorwand der Kontaktpflege besuchte und bei ihrer Arbeit beobachtete. Denn das Internet half zwar mit Fachwissen, aber nicht bei Entscheidungen. Dabei beobachtete ich etwas, das auch zum Handwerken gehörte. Neben den technischen Skills vertrauten die Handwerker offenbar ihrem Bauchgefühl. Jedenfalls schien es mir, als gäbe es so eine alte Handwerker-Jedi-Macht, die seit Anbeginn der Zeit kreiste und die besagte, dass man nur entschlossen und souverän am Gashahn drehen müsste, damit nichts explodierte. Im Internet fand ich das Angebot eines in der Nähe liegenden Baumarktes, wo ich mir einen Bodenschleifer besorgte. Was ich damit machen wolle, fragte der Mann und schob mir den Versicherungszettel rüber. Da ich mir dieses Mal keine Blöße geben wollte, hörte ich auf mein Bauchgefühl und sagte: schleifen! Ich sah ihn fest an, er sah mich fest an, dann sah er weg. Mein Plan schien zu funktionieren.
Schritt 5: Ich, der Heimwerker-King
Ich entwickelte mehr und mehr das Mindset eines Handwerkers. Während ich anfangs wackelig auf der Leiter stand, stand ich jetzt mit einem Fuß in der Dachrinne und dachte daran, wie ich wohl dabei aussah und schrieb im Geiste die passende Unterzeile für das Bild: Die meisten Unfälle passieren zu Hause. Vormittags schrieb ich ein paar Zeilen, dann mähte ich drei Dielen mit dem Schleifgerät. Das Schleifgerät war ein bestialisch lauter Kasten, den man an einem Handgriff über den Boden schob. Ich trug Kopfhörer dabei und hörte Billie Eilish, und nach drei Runden ging mir das Schleifpapier aus. Ich merkte, dass mir der Mann bei der Ausleihe etwas hatte sagen wollen; ich hatte ihm Unrecht getan. Bevor ich zurückfuhr, konsultierte ich das Internet, um einer Schmach zu entgehen. Dort las ich alles über Schleifpapiere, Schleifen, Körnung, Dielenböden, außer-dem einen ziemlich interessanten Text über das „Abziehen“ von Dielen, das man im 18. und 19. Jahrhundert unter Zuhilfenahme kleiner Spachtel gemacht hatte. Zurück im Baumarkt stellte ich mich an den Tresen und wartete, während ich versuchte, einen beiläufigen Eindruck zu machen. Ob ich doch Schleifpapier bräuchte, fragte der Mann freundlich. Ich sagte, dass ich dachte, dass ich noch ausreichend welches hätte, dachte gleichzeitig an die alte Jedi-Macht und an Bauchgefühle. Dann sagte ich, so fest ich konnte: „Gib mir mal Korn 24, Korn 60 und Korn 100, das sollte reichen.“ Der Mann tippte etwas in seinen Computer, stieß sich vom Schreibtisch ab und sagte: „Gute Wahl!“
Schritt 6: ein neues Leben
In den folgenden Wochen machte ich den Boden. Ich versiegelte ihn mit ökologischem Öl. Gegen die Feuchtigkeit dichtete ich das Dach ab. Ich schnitt Fensterglas zurecht, setzte Scheiben ein und verfugte alles. Nachdem alles gestrichen und verputzt war, begann ich mit Kabeln und Steckdosen. Ich fräste Löcher in die Wand und verkabelte alles. Wenn meine Familie zu Besuch kam, die jetzt viel häufiger Kaffee mit Bechern und Thermoskanne mitbrachte, oder Kuchen, tat ich beschäftigt. Einmal hörte ich meinen Bruder im Nebenraum am Telefon sagen: „Ja, und krass. Er macht sogar den Strom selbst. Woher kann der das?“ Ich trug nun ein warmes Gefühl in der Brust vor mir her. Im Haus hingegen war es weniger warm. Ich nahm ein Thermometer und ein Hydrometer, da ich den Eindruck hatte, es sei insgesamt kalt und sehr feucht. Ich maß acht Grad und eine Luftfeuchtigkeit von knapp über 80 Prozent. Ich verstand nicht viel davon, las aber, dass 40 bis 60 Prozent gut seien in Arbeitszimmern, eine konstante Raumtemperatur von 20 Grad Celsius bei 50 Prozent Luftfeuchtigkeit sei das Optimum. Meine Werte waren die Werte eines Kellers, kombiniert mit der Luftfeuchtigkeit eines soeben genutzten Badezimmers.
Also schloss ich Infrarotheizungen an der Decke an und installierte einen Pelletofen. Die Temperatur stieg auf 14 Grad, die feuchten Stellen wurden blass, bis sie weg waren. Nach sechs Wochen begann ich mit dem Feinschliff. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, eine Wand, die besonders kalt war, zu dämmen und dabei neu zu ziehen. Den Trockenbau hatte ich mir für den Schluss aufgehoben, denn in ihm steckte ein besonderes Detail. Mit Spezialfarbe wollte ich eine Whiteboard-Magnet-Wand einziehen, fünf Meter lang, 2,50 Meter hoch. Kopfschüttelnd fuhr mein Vater mit mir zum Baumarkt und von dort in den Fachhandel, weil der Baumarkt längst nicht mehr alles hatte, was ich gebrauchen konnte. Gern hätte ich anderen, jüngeren Handwerkern mein Wissen weitergegeben, aber niemand fragte mich. Trotzdem spürte ich Veränderung und positive Energie in mir, das weitere Leben betreffend. Mein Vater stand am Verkaufstresen im Fachhandel, wo sich Kartons, Geräte und Materialien zu Landschaften auftürmten, und wusste nicht, wo er klingeln sollte. Ein mürrischer Mann mit Schnauzbart sah meinen Vater an, den das verunsicherte. Mein Vater rieb sich die Hände und sagte: „Wir wollen Trockenbau selber machen.“ Der Mann schaute ihn an und sagte: „Selber? Besser nicht.“ Dann grinste er seinen Kollegen an. Der Mann sagte, dann sei es Styropor, das wir bräuchten. Und Holz für den Rahmen. Er hatte offenbar wenig Lust auf seinen Job. Man Vater tippte von einem Bein auf das andere.
Ich hatte natürlich auf diese Gelegenheit gewartet und das Ganze etwas eskalieren lassen, um den Effekt auszukosten, aber jetzt trat ich an meinem Vater vorbei und vor an den Tresen und lehnte mich beiläufig auf, so wie ich das gelernt hatte, und sagte fest: „Mit Styropor dämmt heute keiner mehr. Ich hätte auch gern Aluprofile. Die sind, bei richtigen Zuschnitt, deutlich praktischer und günstiger als Holz.“ Der Mann nickte, tippte alles im Computer an und schickte uns zur Warenausgabe.
Als mein Vater und ich an diesem Tag unter einem grauen Himmel alles einluden, fragte er mich: „Woher weißt du das alles? Was ist passiert?“ Ich lächelte ihn an und sagte stolz und auch ein wenig erleichtert: „Das Internet.“ Dann drückte mich mein Vater seitlich in den Arm und sagte nur knapp: „Das machst du gut, mein Junge.“
Foto: Arne von Brill