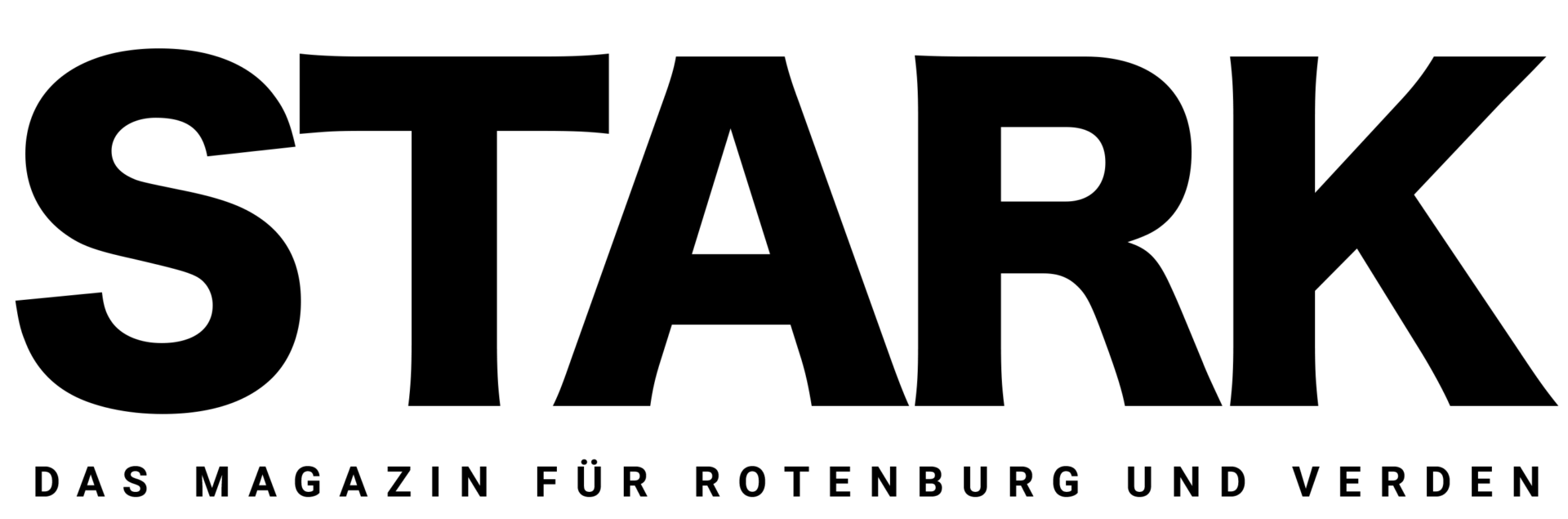Um sein Verhältnis zum Erfolg zu verstehen, muss man in die Vita des Achimers eintauchen. Der Vater: in den 70ern und 80ern ein bedeutender Textil-Großunternehmer. Der Laden, in der Region eine Größe, floriert, die Geschäfte laufen gut. „Wir hatten eine gute Kindheit: ein schönes Haus mit Pool, Autos, Klavier- und Orgelunterricht, keine finanziellen Sorgen.“ Der Berufsweg scheint vorgezeichnet, nach der Lehre studiert er Textilfachbetriebswirt. „Wenn der Vater erfolgreich den Riesentanker steuert, klar, dass man da auch Kapitän werden will“, beschreibt der Lockenkopf seine Berufswahl. Er redet viel in Bildern, nicht nur im Gespräch, auch in seinen Texten, wahrscheinlich auch in seinen Gedanken. Kein Wunder, bei all seinen Grafik-Jobs – das passt. Später steigt er, wie die Schwestern, ins Familienunternehmen ein. Navy-Jeans – das ist ein Begriff in den 80ern. Doch das soll nicht so bleiben. Das Schiff gerät in stürmische Fahrwasser, um im Bild zu bleiben, geht letztendlich auf Grund.
Was bleibt, ist die Musik. Schon früher hatte der Jugendliche im Musterzimmer für die Unternehmenskunden Drumkit, Aufnahmegerät, diverse Instrumente. Viele hat er im Unterricht erlernt, „die Energie war aber immer autodidaktisch.“ Der Vater fand die ersten musikalischen Gehversuche, die ersten Aufnahmen, immer lustig. Jetzt macht er sich Sorgen: Ausgerechnet Musik für den Lebensunterhalt, mit einem Berg Schulden im Rücken? Der Weg zur Berufsmusik, zum Leiter einer Musikschule mit heute mehr als einem Dutzend Honorarkräften und Profimusiker war keine bewusste Entscheidung. „Ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und hab mir gesagt: Jetzt bin ich Musiker – sondern die Musik war immer da, es war das einzige, was ich konnte.“ Aus dem Schlagzeugunterricht für die Tochter eines Nachbarn werden immer mehr Schüler; Simon produziert für Bands, nimmt Aufträge an, tingelt bald mit einer Top-40-Band oder covert Songs im Duo. „Wenn mir jemand gesagt hätte: ‚Mach morgen in der Kirche ein Halleluja, wäre ich zur Stelle gewesen.“ Tanzmucke, Drumhandel, Unterricht – dass es neben aller Leidenschaft auch um Geld geht, daraus macht er keinen Hehl. Irgendwann muss der musikalische Tausendsassa aussortieren. Der Ausstieg aus der Coverband fällt ihm leicht: „Da musst du nur sagen, du willst mehr Geld – dann bist du draußen“, grinst der große Junge. Und wie so oft öffnen sich für Simon neue Türen. Auch, wenn er für jeden Spaß zu haben ist – sein eingesungenes Happy Birthday („die Rechte waren gerade frei“) zählt zu seinen drei erfolgreichsten Songs, seine Fußballhymne wird im lokalen Verein zelebriert – zählt für den Achimer beim vierten Studioalbum seit 2015 die Sinnhaftigkeit.
Sein Credo: Musik „aus gutem Grund: Wenn ich was mache, dann nicht, weil ich mir ausrechne, was ein Song können soll, sondern weil ich ihn machen will“. Genau wie Vorbild Neil Young, den er für seine an Genialität grenzende Trivialität bewundert. Oder Simon and Garfunkel: „Den ‚Boxer‘ wollten wir früher alle spielen können.“ Geprägt wird er später, in der „Sturm- und Drangzeit“, allerdings eher von deutschen Künstlern. Purple Schulz, Rio Reiser, „obwohl der in seinen Aussagen für einen jungen Menschen schon krass war“, oder Grönemeyer. Mit dem wird er oft verglichen, nicht erst seit seinem Hit „Wenn sie tanzt“. Nervt der Vergleich? „Überhaupt nicht – der macht nach wie vor tolle Sachen!“ Ebenso wenig wie die Schublade „Pop“. Die Einflüsse der Sturm- und Drangzeit – Erasure, Depeche Mode oder Vince Clark – wer Simons eingängige, gefällige Melodien hört, würde sie nicht wegdiskutieren. Aber Pop – nicht Singer-Songwriter, oder – wenn es denn deutsch sein soll, Liedermacher? Simon verzieht das Gesicht, nicht nur wegen des heißen Kaffees vor der Nase: „Liedermacher, das geht in eine andere Richtung…. und Singer-Songwriter, das sind die, die an einem Song rumbasteln, bis er gut klingt und sich dann mit der Gitarre allein auf die Bühne stellen…“ Dieses Etikett sprengen die ausgefeilten Arrangements des Multi-Instrumentalisten. Mit dem selbstgewählten Etikett „Populärmusik“, fühlt er sich wohl. Dass er fast trotzig ein „!“ hinter „Pop“ setzt, sei der Pandemie geschuldet: „Da denkt man viel nach.“ Ein Song, der während dieser Zeit entstand, ist „Die Nacht wie eine Wand“, eigentlich die Vertonung eines eigenen Gedichts. „Im schwachen Licht der dunklen Zeit schwelt die kleine Sehnsucht“ – das düstere Timbre löst sich im schwelgerischen, mitreißenden Tanz auf. Ein Elegiker mit Hang zum Optimismus? „Ich bin Zweckoptimist und Fachanwalt für Melancholie“, meint Simon, dem die Songs „zufallen“. Wie bei „Geisterstadt“: „Am Anfang waren da ein paar schräge Riffs, wie bei Beetlejuice.“ In dem funkigen Song geht es jedoch nicht nur um Corona-Leugner, sondern auch um Gentrifizierung – oder? Vielleicht wird er Thema seines neuen Podcastformats, bei dem sich der Komponist gemeinsam mit einem Freund immer einen seiner Songs vornimmt: „Worum geht es, was assoziieren andere damit? Oft ist das etwas ganz anderes, als ich damit ausdrücken wollte – aber das ist okay, jeder hört ja mit einem anderen Erfahrungshintergrund“. Über seine Triebfedern zu sprechen, ist ihm wichtig. „Musik war schon immer meine Rettung, nicht nur finanziell.“ Sich alles von der Seele schreiben – als allgemeines Rezept mag er das nicht verstanden wissen, „jeder verarbeitet das ja anders. Wenn er schreibt oder spielt, „geht ein Licht an“; die Momente, wo Text und Melodien zum ersten Mal zusammen kommen, gehören zu den für ihn berührendsten – „zum Heulen schön, aber eher eine Reinwaschung, eine Katharsis.“
Das neue, komplett selbst produzierte Album heißt „Maximal Till“ – sein persönlichstes Album? Falsch geraten. Der Titel: eine Wortspielerei und Hommage an Mitstreiter Maximilian Suhr. Der ist in den letzten sieben Jahren der Zusammenarbeit längst mehr geworden als „der, der trommelt und fährt“: ein Seelenverwandter, dem er viel zu verdanken habe, „kreativ, verlässlich, mit Lust und voller Liebe für die Sache.“ Und weil er gerade am Schwärmen ist: Auch den Gastmusikern, die ihre Parts – der Pandemie geschuldet – selbst einspielten und schickten, ist er dankbar: „Fast jeder hat alles stehen und liegen lassen, um seinen Part beizutragen. Die Ergebnisse sind fantastisch!“ Für Promotion war bis jetzt noch keine Zeit – der Run auf die Musikschule ist höher denn je, die ausgefallenen Stunden sind fast alle nachgeholt; auch dafür ist Simon dankbar. Denn den Austausch mit seinen jungen Musikschülern möchte er auf keinen Fall missen. Das erste Video hat er bildlich schon im Kopf, abgedreht werden soll es sobald wie möglich. Wenn er sich allerdings entscheiden müsste zwischen YouTube oder Live-Gig, fällt die Wahl nicht schwer – „natürlich Konzert, wir planen schon.“ Und schon läuft das Kopfkino und das jungenhafte Grinsen ist wieder da.
Fotos: Arne von Brill